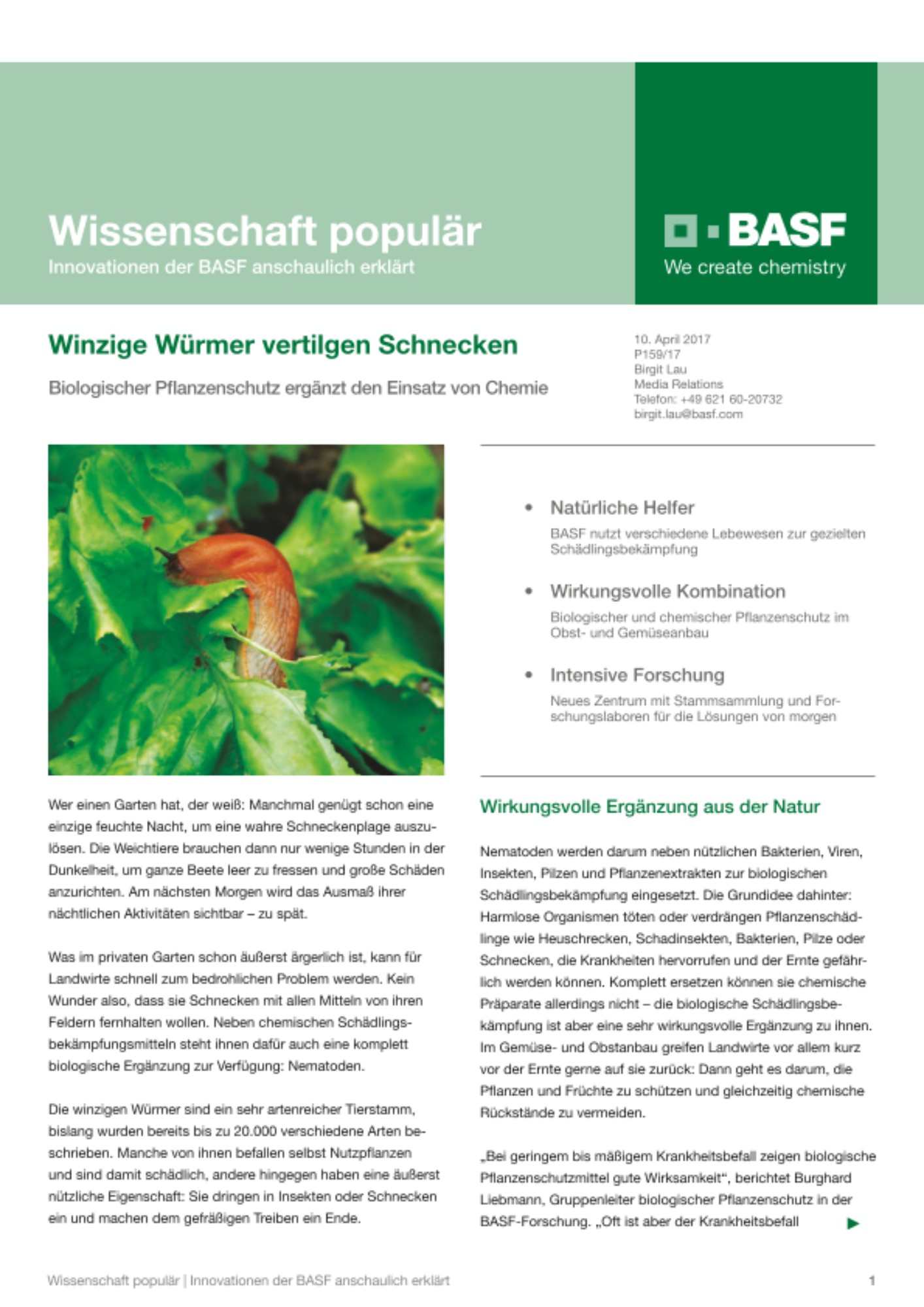Medien
Wissenschaft populär
Biologischer Pflanzenschutz ergänzt den Einsatz von Chemie
Wer einen Garten hat, der weiß: Manchmal genügt schon eine einzige feuchte Nacht, um eine wahre Schneckenplage auszulösen. Die Weichtiere brauchen dann nur wenige Stunden in der Dunkelheit, um ganze Beete leer zu fressen und große Schäden anzurichten. Am nächsten Morgen wird das Ausmaß ihrer nächtlichen Aktivitäten sichtbar – zu spät.
Was im privaten Garten schon äußerst ärgerlich ist, kann für Landwirte schnell zum bedrohlichen Problem werden. Kein Wunder also, dass sie Schnecken mit allen Mitteln von ihren Feldern fernhalten wollen. Neben chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln steht ihnen dafür auch eine komplett biologische Ergänzung zur Verfügung: Nematoden.
Die winzigen Würmer sind ein sehr artenreicher Tierstamm, bislang wurden bereits bis zu 20.000 verschiedene Arten beschrieben. Manche von ihnen befallen selbst Nutzpflanzen und sind damit schädlich, andere hingegen haben eine äußerst nützliche Eigenschaft: Sie dringen in Insekten oder Schnecken ein und machen dem gefräßigen Treiben ein Ende.
Wirkungsvolle Ergänzung aus der Natur
Nematoden werden darum neben nützlichen Bakterien, Viren, Insekten, Pilzen und Pflanzenextrakten zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Die Grundidee dahinter: Harmlose Organismen töten oder verdrängen Pflanzenschädlinge wie Heuschrecken, Schadinsekten, Bakterien, Pilze oder Schnecken, die Krankheiten hervorrufen und der Ernte gefährlich werden können. Komplett ersetzen können sie chemische Präparate allerdings nicht – die biologische Schädlingsbekämpfung ist aber eine sehr wirkungsvolle Ergänzung zu ihnen. Im Gemüse- und Obstanbau greifen Landwirte vor allem kurz vor der Ernte gerne auf sie zurück: Dann geht es darum, die Pflanzen und Früchte zu schützen und gleichzeitig chemische Rückstände zu vermeiden.
„Bei geringem bis mäßigem Krankheitsbefall zeigen biologische Pflanzenschutzmittel gute Wirksamkeit“, berichtet Burghard Liebmann, Gruppenleiter biologischer Pflanzenschutz in der BASF-Forschung. „Oft ist aber der Krankheitsbefall beziehungsweise der Schädlingsdruck so hoch, sodass nur eine Kombination von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln zuverlässig wirkt.“ Und genau hier liegt die Stärke der BASF: „Wir können durch die große Bandbreite unserer Produkte eine individuelle und flexible Lösung anbieten, die auf das Problem und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um der Entwicklung von Wirkstoffresistenzen in Schadinsekten und -pilzen zu begegnen und vorzubeugen“, betont Liebmann.
BASF gehört weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich der biologischen Schädlingsbekämpfung. Erst im April 2016 hat das Unternehmen am Hauptsitz des Unternehmensbereichs Crop Protection in Limburgerhof bei Ludwigshafen ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für biologischen Pflanzenschutz und Saatgutlösungen eröffnet. Es ist der zentrale Standort des weltweiten BASF-Netzwerkes, das aus Forschungs- und Entwicklungsstandorten sowie Testzentren für biologischen Pflanzenschutz und Saatgutlösungen besteht – unter anderem in Brasilien, Frankreich, China, USA und Kanada.
Gezielte Züchtung hilfreicher Organismen
Schon jetzt befinden sich im BASF-Portfolio biologische Pflanzenschutzprodukte gegen zahlreiche Pilze, Insekten und Schnecken, die in der Landwirtschaft und im Gartenbau Probleme bereiten. Die Produktion eines biologischen Schädlingsbekämpfungsmittels hat seinen Anfang allerdings in der Natur. Zunächst haben Forscher aus der Natur, beispielsweise aus Bodenproben oder Pflanzen, Mikroorganismen isoliert, und sie in so genannten Stammsammlungen gelagert. Auch bei der BASF gibt es eine solche Sammlung, in der momentan einige Tausend verschiedene Mikroorganismen auf einen möglichen Einsatz warten. Soll nun ein neues biologisches Pflanzenschutzmittel entwickelt werden, wird hier nach einem Orga nismus gesucht, der genau das kann, was benötigt wird, also beispielsweise gegen einen bestimmten Pilz oder ein Schad insekt wirken. Ist er gefunden, fängt die Arbeit aber erst an: Es müssen ausreichende Mengen dieses Organismus in so genannten Fermentern gezüchtet werden. Und die Lebewesen sind mitunter etwas anspruchsvoll. „Nährmedium, Temperatur, Sauerstoffgehalt, alles beeinflusst ihr Wohlbefinden und damit die Vermehrung“, so der Biologe.
Damit die winzigen Schädlingsbekämpfer unbeschadet gelagert und von dem Landwirt gut gehandhabt werden können, werden sie anschließend formuliert, also in ein Produkt mit guten Anwendungseigenschaften überführt. Und auch hier ist das Know-how der Forscher gefragt. „Die Mikroorganismen müssen in eine Art Ruhezustand überführt werden, aber sie dürfen auch nicht austrocknen und sterben. Und da jeder Organismus auf äußere Einflüsse unterschiedlich reagiert, bedarf es hier viel Erfahrung und Wissen, um ein gutes Produkt zu entwickeln“, sagt Liebmann. Das Ergebnis ist ein pulver - förmiges oder flüssiges Produkt, das der Landwirt in Wasser auflöst oder verdünnt und anschließend auf die Pflanzen oder den Boden versprühen kann. Möchte er damit Schnecken zu Leibe rücken, kann er das Molluskizid Nemaslug anwenden – ein Pulver, in dem sich Nematoden der Gattung Phasmarhabditis hermaphrodita befinden. Sobald die Nematoden auf eine Schnecke treffen, dringen sie über deren Atemöffnung in den Körper ein. Nach zwei Tagen vergeht der Schnecke der Appetit und sie stirbt nach etwa einer Woche.
Einfache Grundprinzipien, die aus der Natur stammen und äußerst wirksam sind: Das macht die biologische Schädlingsbekämpfung so interessant. „In Zukunft wollen wir weitere neue Anwendungsfelder für den biologischen Pflanzenschutz erschließen.“ Ein Beispiel ist der Einsatz nützlicher Nematoden zum Schutz von Zitrusbäumen. Hier führt BASF gerade das Produkt Nemasys® R in Florida in den Markt ein. Die darin enthaltenen Nematoden der Gattung Steinernema riobravae wirken gegen Käferlarven, die die Wurzeln von Zitrusbäumen anfressen und damit eine große Bedrohung für Floridas Orangenproduzenten darstellen. Liebmann ist überzeugt: „Wir sind mit unseren Möglichkeiten im biologischen Pflanzenschutz noch lange nicht am Ende angelangt."
Nematoden schützen Zitrusbäume
Interview mit Professor Larry Duncan, der sich an der University of Florida mit dem biologischen Schutz von Zitruspflanzen beschäftigt.
Professor Duncan, Sie forschen im Bereich biologischer Pflanzenschutz. Warum ist dieser wichtig?
Die große Mehrheit potenzieller Schädlinge in Baumkronen ist durch bereits vorkommende oder eingeführte natürliche Feinde biologisch kontrolliert. Diese Zusammenhänge sind erforscht und es wurden viele Vorgehensweisen entwickelt, um die biologische Bekämpfung oberirdischer Schädlinge zu fördern. Die Leistung von biologischen Mitteln in der Erde können jedoch noch nicht voll ausgeschöpft werden, da wenig über die Nahrungsketten im Boden bekannt ist. Indem wir lernen, welche Organismen die Anzahl von Schädlingen im Boden verringern und was diese Wechselwirkungen beeinflusst, können wir Wege entdecken, die Kontrolle über Schädlinge in der Erde durch natürlich vorkommende oder eingeführte biologische Feinde zu behalten oder zu steigern.
Bei Ihrer Arbeit konzentrieren Sie sich auf Zitruspflanzen. Welchen Herausforderungen gibt es hier?
Ich beschäftige mich unter anderem mit dem Rüsselkäfer Diaprepes abbreviatus: Er ernährt sich von jungen Blättern und legt dort seine Eier ab. Die Larven fallen herunter, ernähren sich von den Wurzeln und verpuppen sich im Boden. Der Larvenfraß schädigt den Baum sehr. Zudem können pflanzenpathogene Pilze in die Wunden eindringen. Nach der Verpuppung schlüpfen erwachsene Käfer, die aus dem Boden kommen, um sich zu paaren und Eier zu legen. In Obstplantagen mit starkem Befall sterben die Bäume innerhalb von 1 oder 2 Jahren. Besonders dringend wurde das Problem, als 2005 in Florida erstmals die Zitruskrankheit "huanglongbing" auftrat und das Wurzelsystem der Bäume weiter schädigte.
Was kann man dagegen tun?
Es ist generell schwierig, den Lebenszyklus zwischen Blatt und Boden mit einem Pestizid zu unterbrechen, das nur kurze Zeit auf den Blättern aktiv ist. Und es gibt keine zugelassenen Pestizide, mit denen wir die Larven im Boden wirksam bekämpfen können. Darum studieren wir intensiv, wie man Diaprepes abbreviatus biologisch unter Kontrolle bringen kann. Dabei haben wir erkannt, dass insektentötende Nematoden wie beispielsweise Steinernema riobrave hier sehr vielversprechend sind. Sie können die Larven des Käfers befallen und zusammen mit dem Management von erwachsenen Käfern dabei helfen, die Schädlingsdichte auf ein geringeres Level zu reduzieren.
Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft
Pflanzenschutzmittel schützen Pflanzen vor Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern. Unterschieden werden chemische und biologische Pflanzenschutzmittel. In der konventionellen Landwirtschaft können nach den Vorgaben der so genannten "guten fachlichen Praxis" synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Im Unterschied dazu gibt es in der ökologischen Landwirtschaft eine rechtliche Verpflichtung, auf chemische Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Landwirte können auf eine eng begrenzte Auswahl von Pflanzenschutzmitteln zurückgreifen, die in der Natur vorkommen. Biologische Pflanzenschutzmittel können sowohl in der konventionellen als auch ökologischen Landwirtschaft eingesetzt werden. BASF bietet verschiedene biologische Pflanzenschutzmittel für rund 20 unterschiedliche Krankheiten und Schädlinge an. So zum Beispiel das biologiche
Fungizid Serifel® auf Basis von Bacillus amyloliquefaciens, das gegen eine große Bandbreite von Pilzkrankheiten wirkt wie zum Beispiel Grauschimmel, echter Mehltau, Weißstängeligkeit. Gegen die weißen Fliegen, Fransenflügler, Milben und einige Insekten mehr hilft das Produkt Velifer®. Und ein Mittel gegen Schnecken ist Nemaslug®.
Weitere Informationen zu den biologischen Pflanzenschutzmitteln der BASF unter: www.agriculture.basf.com
P-17-159