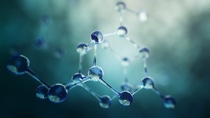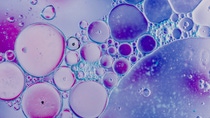Innovation
Patrick Keil
Es ist der Graus eines jeden Autobesitzers: das Auto rostet. Früher war das schon nach wenigen Jahren ein viel gesehenes Phänomen, das sogar einen eigenen Namen hatte – die Rostlaube. Heute sieht man stark verrostete Autos seltener. Das liegt unter anderem an Menschen wie Patrick. Er ist Forscher bei der BASF Coatings GmbH und damit maßgeblich daran beteiligt, dass der Korrosionsschutz auf dem Automobil richtig funktioniert.
Neben Korrosionsschutz durch Beschichtungen forscht Patrick unter anderem an Korrosionsinhibitoren. Es handelt sich dabei um chemische Substanzen, die die Korrosionsbeständigkeit von Metallen und Legierungen erhöht. Korrosionsinhibitoren können auf verschiedene Weise wirken, beispielsweise durch Bildung einer schützenden Passivierungsschicht auf der Metalloberfläche, die den Kontakt mit korrosiven Umgebungen, wie Wasser und Sauerstoff, reduziert. Sind Sie interessiert? Hier erzählt Patrick mehr über seine Forschung und weshalb Korrosionsschutz einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.

Beim Auto ist es klar, aber wo sonst ist Korrosionsschutz noch wichtig im Alltag?
Korrosion ist ein Begriff, der viel mehr umfasst als das, was wir landläufig unter „Rosten“ verstehen. Rosten ist der Prozess, bei dem Eisen und seine Legierungen wie Stahl durch chemische Reaktionen mit Sauerstoff und Wasser abgebaut wird, was wiederum zur Bildung von Eisenoxiden und -hydroxiden führt, die wir als den rötlich schimmernden Rost kennen. Andere Metalle zeigen anderen Formen der Metallkorrosion. Korrosion ist lateinisch und bedeutet einfach nur „zersetzen“ oder „zerfressen“. Im Grunde ist jede messbare Veränderung eines Werkstoffs, die durch seine Umgebung bewirkt wird, Korrosion. Dazu zählt auch sich zersetzendes Gestein oder in der Medizin die Zersetzung von Gewebe.
Eines der ersten „modernen“ Korrosionsschutzmittel, die der Mensch erfunden hat, waren chromathaltige Lösungen oder der Einsatz von bleihaltigen Pigmenten. Sowohl chromathaltige Lösungen als auch bleihaltige Pigmente wurden allerdings für Mensch und Umwelt als äußerst bedenklich eingestuft und sind mittlerweile größtenteils verboten. So etwas bedeutet eine riesengroße Triebkraft für die Branche. Produkte, die eigentlich gut funktionieren, kommen regulatorisch auf den Prüfstand und sind dann entweder gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt nutzbar.
Wir sind daher kontinuierlich auf der Suche nach neuen Konzepten, die gut funktionieren und zugleich umweltschonend und nachhaltig sind.

Was waren die großen Meilensteine im Bereich Korrosionsschutz und woran arbeitest du heute?
In den letzten 45 Jahren gab es auf dem Gebiet so einige Durchbrüche und Meilensteine. Da wäre z.B. die Einführung von verzinktem Stahl, die Phosphatierung und kathodische Tauchlackierung in der Automobilindustrie, die den Weg frei gemacht hat für eine komplett chromatfreie Behandlung oder auch die Einführung von wasserbasierten Lacken.
Die Korrosionsschutzkonzepte von heute sind komplexer und sehr anwendungsspezifisch. Während man früher als eierlegende Wollmilchsau, fast überall Chromate einsetzten konnte, werden heute oft fortschrittliche und mehrkomponentige Systeme verwendet, die im Zusammenspiel dann den nötigen Korrosionsschutz liefern. Davon abgesehen ist man früher ganz anders in die Entwicklung eines neuen Produkts gegangen. Damals gab es viel Trial-and-Error, heute nutzen wir intensiv Machine Learning (ML) und künstliche Intelligenz (KI). Hierbei analysieren wir aus der Menge an historischen Daten früheren Forschungsarbeiten, chemischen Eigenschaften und Testergebnissen. Mit Hilfe von maschinellem Lernen kann die KI Muster erkennen, um so Forscher und Entwickler dabei zu unterstützen, Vorhersagen darüber zu treffen, welche chemischen Verbindungen am vielversprechendsten sind, um die Korrosion von Metallen zu inhibieren. Darüber hinaus simulieren wir die Wechselwirkungen zwischen den Inhibitoren und verschiedenen Materialien in unterschiedlichen komplexen Umgebungen, ohne dass zeitaufwendige Korrosionsuntersuchungen notwendig sind. Dies beschleunigt den Entwicklungsprozess und führt zu effektiveren und nachhaltigeren Lösungen, die speziell auf die Anforderungen bestimmter Anwendungen und Umgebungen zugeschnitten sind. Dazu gehört auch, die Zukunft der Branche im Blick zu behalten und künftige Trends zu antizipieren. Für Korrosionsinhibitoren haben wir bereits vor einigen Jahren ein Projekt gestartet. Dabei ist ein Konzept entstanden, bei dem wir gemeinsam mit der zentralen Forschung und den Geschäftsbereichen sowie Hochschulpartnern durch ML schneller und gezielter nach dem richtigen Inhibitor für eine bestimmte Anwendung suchen können. Diese Inhibitoren finden schließlich in diese Korrosionsinhibitoren finden schließlich in verschiedenen Geschäftsbereichen der BASF ihre Anwendung.

Wie genau trägt Korrosionsschutz zur Nachhaltigkeit bei?
Korrosionsschutz ist ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit. Ohne geeignete Schutzmechanismen würden viele unserer alltäglichen Gegenstände nicht existieren. Jeder weiß, wie schnell unbehandelter Stahl rostet. Stellen wir uns zum Beispiel ein Auto vor, ein Smartphone oder eine Brücke. All diese Dinge nutzen wir täglich, ohne uns darüber Gedanken zu machen, dass sie ohne Korrosionsschutz in relativ kurzer Zeit korrodiert wären und reparieret oder sogar ausgetauscht werden müssten. Guter Korrosionsschutz verhindert oder verlangsamt den Prozess enorm. Das bedeutet für unser Auto: je besser der Korrosionsschutz, desto länger die Lebensdauer der Karosserie – und das ist nachhaltig.
Aber auch im Bereich des Carbon Management kann Korrosionsschutz punkten. Jährlich werden immense Mengen an Stahl produziert, die alle geschützt werden müssen. Nach unserer heutigen Logik würden wir Korrosionsschutzprodukte wie Lacke oder Passivierungen als „Extend the Loop“-Produkte bezeichnen, da sie ein Objekt schützen und somit die Lebensdauer maßgeblich verlängern. Laut einer Publikation von Mariano Iannuzzi und Gerald Frankel in npj Materials Degradation wird der CO2-Fußabdruck von korrodiertem Stahl auf bis zu 300-700 Mt/a geschätzt. Mit Korrosionsschutz haben wir daher einen großen Hebel, wenn es darum geht die die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Durch den Einsatz von modernem Korrosionsschutz kann der CO2-Fußabdruck eines Produktes zusätzlich reduziert werden. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist hier ebenfalls zentral, da Stahl ein wertvolles Gut ist, das recycelt und wiederverwendet wird.
Wie beeinflusst der Korrosionsschutz den CO2-Verbrauch?
Letztes Jahr sind weltweit um die zwei Gigatonnen Stahl produziert worden. Zwei Gigatonnen Stahl bedeuten mindestens 3-4 Gigatonnen CO2-Emissionen beim Herstellungsprozess. Bei recyceltem und grünem Stahl ist dieser Wert deutlich niedriger. Ein großer Teil des Stahls wurde hergestellt, um korrodierten Stahl zu ersetzen. Da merkt man, dass man mit den Technologien, mit denen man täglich zu tun hat, einen riesengroßen Einfluss hat, um Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten.

Welche Themen umfasst deine tägliche Arbeit?
Meine Aufgaben sind extrem vielfältig und umfassen ein tiefes Verständnis von metallischen Werkstoffen, Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen im Allgemeinen. Dazu zählen z.B. auch die Korrosionsschutzinhibitoren, Vorbehandlungstechnologien und auch die Analyse von Schadensbildern. Ich sehe mich aber auch ein bisschen an der Schnittstelle zu unseren Kunden auf der einen Seite und der akademischen Welt auf der anderen Seite. Oft ist es ja so, dass es einen Trend gibt oder auch ein ungelöstes Problem auf der Seite unseres Kunden. Meine Aufgabe ist es zuzuhören und das Gehörte dann zu hinterfragen, in ein akademisches Umfeld zu bringen und eine Lösung zu finden.
Vor einigen Jahren waren zum Beispiel Magnesiumwerkstoffe im Leichtbau ein großes Thema. Mithilfe einer Hochschulkooperation haben wir jedoch festgestellt, dass hier ein neuer uns unbekannter Korrosionsmechanismus stattfindet, für den wir aktuell noch kein Gegenmittel haben. Mit diesem vorwettbewerblichen Fachwissen konnten wir dann unsere Kunden entsprechend beraten. An einer Lösung forschen wir gerade intensiv. Und solche technischen Grenzen bringen uns ja letztendlich auch weiter, da unsere Forschung exakt dort ansetzt und uns herausfordert auch mal Out-of-the-Box zu denken. Das ist es, was mich an meiner Arbeit motiviert.