Medien
Die Quelle des Neuen
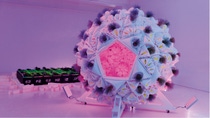
Sie sind eine treibende Kraft – ohne Innovationen kommen wir nicht voran. Doch was macht sie aus? Und wie lassen sich Innovationen hervorlocken? Unsere Spurensuche geht wissenschaftlichen Erkenntnissen nach, zeigt, wie BASF anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums mit neuen Methoden den Innovationsgeist wachruft, und beobachtet Forscher bei ihren Durchbrüchen.

Unerlässlich, aber schwer zu fassen
Fortschritt in der Geschäftswelt, der Wissenschaft, der Kunst und der Gesellschaft ist nur durch Innovation möglich – wenn wir erfolgreich neue Ideen in bessere Technologien, Produkte, Verfahren und Dienstleistungen übersetzen. Aus diesem Grund investieren Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen rund um die Welt jedes Jahr Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung. Einem Bericht der Unternehmensberatung PwC zufolge haben im vergangenen Jahr die 1.000 führenden Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung mehr als 540 Milliarden€ (600 Milliarden$) aus gegeben, was etwa 40% der weltweiten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung entspricht.
Es geht nicht nur ums Geld
Für diejenigen, die es richtig anstellen, machen sich all diese Anstrengungen mehr als bezahlt. Investoren sind bereit, einen hohen Preis für An teile an Firmen wie Apple und Google oder für Startups zu bezahlen, von denen sie glauben, dass sie bedeutendes Innovationspotenzial haben. Doch es hat sich für Unternehmen als frustrierend schwierig erwiesen, permanent Innovationen zu liefern. Es geht keinesfalls nur ums Geld – nach zehn Jahren Forschung hat PwC keinen direkten Zusammenhang zwischen den Ausgaben einer Organisation für Forschung und Entwicklung und ihrer Innovationsfähigkeit gefunden. Und auch formale Abläufe allein sind es nicht. Unternehmen und Wissenschaftler haben eine Reihe von Modellen entwickelt, um den Verlauf von einer Idee oder einem identifizierten Bedarf bis hin zur vollendeten Innovation zu beschreiben, aber eine Patentlösung zum Erfolg konnte niemand definieren. Wie können wir dieses unverzichtbare und doch so schwer zu fassende Element also fördern? Mehrere neue Ansätze zeichnen sich ab.
„Führende Unternehmen stellen sich die Frage, wie man die besten internen Leute mit den besten Leuten außerhalb zusammenbringen kann.“
Dr. Ellen Enkel, Professorin für Innovationsmanagement an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen
Nicht einfach nur mehr Ideen, sondern bessere
In den vergangenen Jahren haben viele Organisationen erkannt, dass große Budgets für Forschung und Entwicklung nicht zwangsläufig zu gewinnbringenden Innovationen führen. Teilweise lässt sich das auf ein Phänomen zurückführen, das HarvardProfessor Clayton Christensen als „InnovatorenDilemma“ bezeichnet. In seinem 1997 erschienenen Buch „The Innovator’s Dilemma“ argumentierte Christensen, dass erfolgreiche Firmen ihre Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung zwangsläufig darauf konzentrieren, die gegenwärtigen und erklärten Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Dadurch werden sie anfällig gegenüber Konkurrenten, die „disruptive Innovationen“ einführen, die unausgesprochene oder zukünftige Kundenbedürfnisse befriedigen, fundamental andere Technologien nutzen oder völlig neue Kundengruppen bedienen.
Menschen verbinden
In dem Bemühen, sich besser auf Umbrüche vorzubereiten, versuchen viele Organisationen nun, ihre Suche nach neuen Ideen auszuweiten. „Egal, wie groß ein Unternehmen ist, es wird niemals alle klugen Köpfe und alle guten Ideen in sich vereinen“, sagt Dr. Ellen Enkel, Professorin für Innovationsmanagement an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. „Deshalb stellen sich führende Unternehmen die Frage, wie man die besten internen Leute mit den besten Leuten außerhalb zusammenbringen kann.“ Um diese inzwischen als „Open Innovation“ bekannte Entwicklung zu erleichtern, bauen Unternehmen viel engere Beziehungen zu Lieferanten und Branchenpartnern auf und suchen an Universitäten und bei Startups nach Teams und Einzelpersonen mit brillanten Ideen. Sie ermutigen sowohl bestehende als auch potenzielle Kunden, an den Innovationsprozessen teilzuhaben. Außerdem veranstalten sie interne und externe Wettbewerbe, um nach neuen Ideen und Lösungen für schwierige Probleme zu suchen.
„Jede wirklich radikale Innovation wird auch Brüche erzeugen.“
Ashley Hall, PhD, Professor für Design-Innovation am Royal College of Arts in London/England
Mit neuen Ideen spielen
Manchmal ist die größte Hürde für Innovation die Notwendigkeit, das Alte einzureißen, um Platz für das Neue zu schaffen. Bedeutende Innovationen stören die bestehende Ordnung und bedrohen häufig etablierte Funktionen, Fähigkeiten oder Einrichtungen. „Jede wirklich radikale Innovation wird auch Brüche erzeugen“, meint Ashley Hall, PhD und Professor für DesignInnovation am Royal College of Art in London/England. „Und das heißt, dass dadurch jemand bedroht werden wird.“

Innovation durch Spiel
Diesen Punkt greift auch Henrik Sproedt, Assistenzprofessor für InnovationsPraktiken an der Süddänischen Universität, auf. „Manchmal laufen Menschen nur zu kreativer Höchstform auf, um Veränderungen zu verhindern“, sagt er. Dieses Phänomen zeigt sich nicht nur in Unternehmen; die Geschichte der Innovation ist auch eine Geschichte des Widerstands gegen Veränderung: Von der „Sabotage“ von Webstühlen durch wütende Arbeiter während der industriellen Revolution bis hin zu jüngeren Bedenken im Hinblick auf neue Technologien wie die Gentechnologie.
Seine Forschung hat Sproedt dazu veranlasst, das Vorgehen von Unternehmen beim Innovationsmanagement infrage zu stellen. „Viele Organisationen nutzen StageGate®Prozesse, um Risiken zu minimieren“, sagt er. Doch dafür „muss jemand die Bewertungskriterien festlegen.“ Wahre Innovation sei aber zu „komplex und chaotisch“, um sich reibungslos in derart formalisierte Bewertungssysteme einzufügen.Hall stimmt dem zu und weist darauf hin, dass Unternehmen viel von der Arbeitsweise von Designern lernen könnten. „Designer tendieren dazu, nicht mit der Frage bereits die Antwort vorwegzu nehmen“, stellt Hall fest. „Sie schweifen ab und experimentieren und sind bereit, neue Richtungen einzuschlagen, wenn sich ihnen diese eröffnen.“ Tatsächlich, so Sproedt, sollten innovative Tätigkeiten weniger Ähnlichkeit mit Arbeit und dafür mehr mit Spiel haben. „Für den Menschen ist das der natürlichste Weg, um Neues zu begreifen, weil beim Spielen die Angst vor dem Scheitern fehlt, die Kreativität hemmt.“
„Innovative Tätigkeiten sollten weniger Ähnlichkeit mit Arbeit und dafür mehr mit Spiel haben. Für den Menschen ist das der natürlichste Weg, um Neues zu begreifen, weil beim Spielen die Angst vor dem Scheitern fehlt, die Kreativität hemmt.“
Henrik Sproedt, Assistenzprofessor für Innovations-Praktiken an der Süddänischen Universität.
Eine offene und innovative Kultur schaffen
Wie ermutigen und fördern Unternehmen also Innovation? Man ist sich zunehmend einig, dass die Unternehmenskultur der ausschlaggebende Faktor ist. „Es gibt heute keinen zufriedenstellenden Maßstab für Innovationsfähigkeit“, so Ellen Enkel. „Sollte ich aber einen erschaffen, würde ich zwei Dinge messen wollen: Wie offen sind meine Mitarbeiter gegenüber Veränderungen und wie gut ist meine Organisation mit der Außenwelt vernetzt?“ Sproedt findet, dass viele Unternehmen Offen heit sowohl innerhalb ihrer eigenen Organisation als auch außerhalb erleichtern müssen. „Man muss alle Stakeholder frühzeitig zusammenbringen, um ihnen Zeit zu geben, eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln“, sagt er. Doch er räumt ein, dass dies Menschen schwerfallen kann, da die Notwendig keit, Ideen und Ansätze aus dem gesamten Unternehmen zu akzeptieren, dazu führen kann, die eigene berufliche Identität infrage zu stellen.
Jeder kann mitmachen
Doch selbst potenziell unangenehme neue Arbeitsregelungen und beziehungen können ein Katalysator für Innovation sein. „Innovation geschieht tendenziell zwischen den Dingen, und je größer die Herausforderungen in diesen Zwischenräumen sind, desto besser“, sagt Hall. Er hebt auch eine der wichtigsten Erkenntnisse der jüngsten Zeit hervor: „Das Tolle an Innovation ist, dass sie nicht einem einzigen Teil einer Organisation gehört – jeder kann daran teilhaben.“
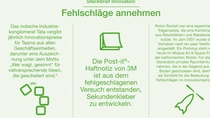

Gemeinsam Neues schaffen
Ideen und Konzepte entwickeln, um die Zukunft zu gestalten: Anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums eröffnet BASF mit dem Creator Space™ neue Denkräume. Im Mittelpunkt steht die kreative Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Wissenschaftlern sowie weiteren Gruppen. Hierfür wurden zahlreiche Co-Creation-Aktivitäten auf globaler und regionaler Ebene initiiert. Bei der Durchführung unterstützen verschiedene Methoden wie Jammings, Ideenwettbewerbe oder Open Innovation Challenges.








